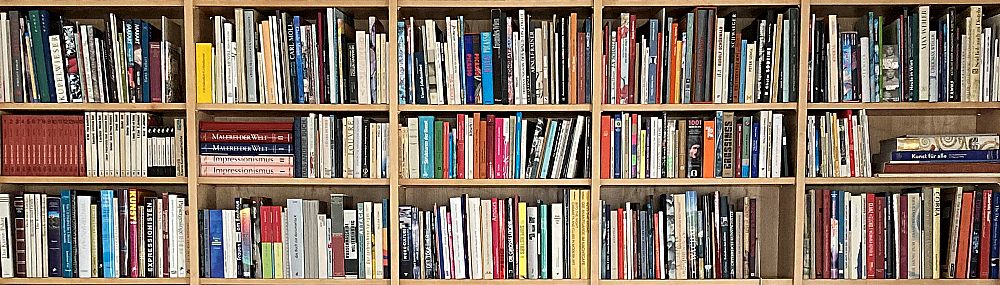Diese Erinnerung Stefan Zweigs an das „alte Wien“ ist die gekürzte Fassung eines Vortrags mit dem Titel „Das Wien von gestern“, den Zweig kurz vor seiner durch den Nationalsozialismus erzwungenen Emigration nach Brasilien am 26. April 1940 im Pariser Théâtre Marigny hielt. Wien sei, so meinte Zweig, nicht zufällig „die klassische Stadt der Musik geworden“.
„Metastasio, der König der Oper, lässt sich gegenüber der kaiserlichen Hofburg nieder, Haydn lebt im gleichen Hause, Gluck unterrichtet die Kinder Maria Theresias, und zu Haydn kommt Mozart, zu Mozart Beethoven, und neben ihnen sind Salieri und Schubert, und nach ihnen Brahms und Bruckner, Johann Strauss und Lanner, Hugo Wolf und Gustav Mahler. Keine einzige Pause durch hundert und hundertfünfzig Jahre, kein Jahrzehnt, kein Jahr, wo nicht irgendein unvergängliches Werk der Musik in Wien entstanden wäre. Nie ist eine Stadt gesegneter gewesen vom Genius der Musik als Wien im achtzehnten, im neunzehnten Jahrhundert.
Nun können Sie einwenden: von all diesen Meistern sei kein einziger außer Schubert ein wirklicher Wiener gewesen. Das denke ich nicht zu bestreiten. Gewiss, Gluck kommt aus Böhmen, Haydn aus Ungarn, Caldara und Salieri aus Italien, Beethoven aus dem Rheinland, Mozart aus Salzburg, Brahms aus Hamburg, Bruckner aus Oberösterreich, Hugo Wolf aus der Steiermark. Aber warum kommen sie aus allen Himmelsrichtungen gerade nach Wien, warum bleiben sie gerade dort und machen es zur Stätte ihrer Arbeit? Weil sie mehr verdienen? Durchaus nicht. Mit Geld ist weder Mozart noch Schubert besonders verwöhnt worden, und Joseph Haydn hat in London in einem Jahr mehr verdient als in Österreich in sechzig Jahren. Der wahre Grund, dass die Musiker nach Wien kamen und in Wien blieben, war: sie spürten, dass hier das kulturelle Klima der Entfaltung ihrer Kunst am günstigsten war. Wie eine Pflanze den gesättigten Boden, so braucht produktive Kunst zu ihrer Entfaltung das aufnehmende Element, die Kennerschaft weiter Kreise, sie braucht, wie jene Sonne und Licht, die fördernde Wärme einer weiten Anteilnahme – immer wird die höchste Stufe der Kunst dort erreicht, wo sie Passion eines ganzen Volkes ist. Wenn alle Bildhauer und Maler Italiens im 16. Jahrhundert sich in Florenz versammeln, so geschieht es nicht nur, weil dort die Medicäer sind, die sie mit Geld und Aufträgen fördern, sondern weil das ganze Volk seinen Stolz in der Gegenwart der Künstler sieht, weil jedes neue Bild zum Ereignis wurde, wichtiger als Politik und Geschäft, und weil so ein Künstler den andern ständig zu überholen und zu übertreffen genötigt war.
So konnten auch die großen Musiker keine idealere Stadt für Schaffen und Wirken finden als Wien, weil Wien das ideale Publikum hatte, weil die Kennerschaft, weil der Fanatismus für die Musik dort alle Gesellschaftsschichten gleichmäßig durchdrang. (…) Wenn der Wiener Bürger die Zeitung öffnet, ist sein erster Blick nicht, was in der Welt der Politik vorgeht; er schlägt das Repertoire der Oper und des Burgtheaters nach, welcher Sänger singt, welcher Kapellmeister dirigiert, welcher Schauspieler spielt. Ein neues Werk wird zum Ereignis, eine Premiere, das Engagement eines neuen Kapellmeisters, eines neuen Sängers an der Oper ruft endlose Diskussionen hervor, und der Kulissentratsch über die Hoftheater erfüllt die ganze Stadt. Denn das Theater, insbesondere das Burgtheater, bedeutet den Wienern mehr als eben bloß ein Theater; es ist der Mikrokosmos, der den Makrokosmos spiegelt, ein sublimiertes konzentriertes Wien innerhalb Wiens, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. (…)
Als das alte Gebäude des Burgtheaters abgerissen wird, dasselbe in dem die „Hochzeit des Figaro“ zum erstenmal erklang, ist ein Trauertag in ganz Wien. Um sechs Uhr morgens stellen sich die Enthusiasten vor den Türen an und stehen dreizehn Stunden bis abends, ohne zu essen, ohne zu trinken, nur um der letzten Vorstellung in diesem Hause beiwohnen zu können. Von der Bühne brechen sie sich Holzsplitter heraus und bewahren sie genau so wie einstmals Fromme die Splitter vom heiligen Kreuz. Nicht nur der Dirigent, der große Schauspieler, der gute Sänger wird wie ein Gott vergöttert, diese Leidenschaft geht über auf den unbeseelten Raum. Ich war selbst beim letzten Konzert in dem alten Bösendorfer-Saal. Es war gar kein besonders schöner Saal, der da abgerissen wurde, eine frühere Reitschule des Fürsten Liechtenstein, einfach in Holz getäfelt. Aber er hatte die Resonanz einer alten Geige, und Chopin und Brahms hatten noch darin gespielt und Rubinstein und das Roséquartett. Viele Meisterwerke waren dort zum erstenmal für die Welt erklungen, es war der Ort gewesen, wo alle Liebhaber von Kammermusik durch Jahre und Jahre Woche für Woche einander begegnet waren, eine einzige Familie. Und da standen wir nun nach dem letzten Beethovenquartett in dem alten Raum und wollten nicht, dass es zuende war. Man tobte, man schrie, einige weinten. Im Saal wurden die Lichter gelöscht. Es half nichts. Alle blieben im Dunkel, als wollten sie es erzwingen, dass auch dieser Saal bliebe, der alte Saal. So fanatisch empfand man in Wien nicht nur für die Kunst, die Musik, sondern sogar für die bloßen Gebäude, die mit ihr verbunden waren.
Übertreibung, werden Sie sagen, lächerliche Überschätzung! Und so haben wir selbst manchmal diesen geradezu irrwitzigen Enthusiasmus der Wiener für Musik und Theater empfunden. Ja, er war manchmal lächerlich, ich weiß es, wie zum Beispiel damals, als die guten Wiener sich als Kostbarkeit Haare von den Pferden aufhoben, die den Wagen von Fanny Elßler gezogen, und ich weiß auch, dass wir diesen Enthusiasmus gebüßt haben. Während sich Wien und Österreich in seine Theater, seine Kunst vernarrte, haben die deutschen Städte uns überholt in Technik und Tüchtigkeit und sind uns in manchen praktischen Dingen des Lebens vorausgekommen. Aber vergessen wir nicht: solche Überwertung schafft auch Werte. Nur wo wahrer Enthusiasmus für die Kunst besteht, fühlt sich der Künstler wohl, nur wo man viel fordert von der Kunst, gibt sie viel. Ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo der Musiker, der Sänger, der Schauspieler, der Dirigent, der Regisseur strenger kontrolliert und zu größerer Anspannung gezwungen war als in Wien. Denn hier gab es nicht nur die Kritik bei der Premiere, sondern eine ständige und unbeugsame Kritik durch das gesamte Publikum. In Wien wurde kein Fehler übersehen bei einem Konzert, jede einzelne Aufführung und auch die zwanzigste und hundertste war immer überwacht von einer geschulten Aufmerksamkeit von jedem Sitzplatz aus: wir waren ein hohes Niveau gewohnt und nicht bereit, einen Zoll davon nachzugeben.
Diese Kennerschaft bildete sich in jedem einzelnen von uns schon früh heraus. Als ich noch auf das Gymnasium ging, war ich nicht einer, sondern einer aus zwei Dutzend, die bei keiner wichtigen Vorstellung im Burgtheater oder in der Oper fehlten. Wir jungen Menschen kümmerten uns als rechte Wiener nicht um Politik und nicht um Nationalökonomie, und wir hätten uns geschämt, etwas von Sport zu wissen. Noch heute kann ich Cricket nicht von Golf unterscheiden, und die Seite Fußballbericht in den Zeitungen ist für mich chinesisch. Aber mit vierzehn, mit fünfzehn Jahren merkte ich schon jede Kürzung und jede Flüchtigkeit bei einer Aufführung; wir wussten genau, wie dieser Kapellmeister das Tempo nahm und wie jener. Wir bildeten Parteien für einen Künstler und für den ändern, wir vergötterten sie und hassten sie, wir zwei Dutzend in unserer Klasse. Aber nun denken Sie sich uns, diese zwei Dutzend einer einzigen Schulklasse multipliziert mit fünfzig Schulen, mit einer Universität, einer Bürgerschaft einer ganzen Stadt, und Sie werden verstehen, welche Spannung bei uns in allen musikalischen und theatralischen Dingen entstehen musste, wie stimulierend diese unermüdliche unerbittliche Kontrolle auf das Gesamtniveau des Musikalischen, des Theatralischen wirkte. Jeder Musiker, jeder Künstler wusste, dass er in Wien nicht nachlassen durfte, dass er das Äußerste bieten müsse, um zu bestehen. (…)
Aber ich sehe, ich gerate in Gefahr, ein Bild von unserem Wien zu geben, das gefährlich jenem süßlichen und sentimentalen nahekommt, wie man es aus der Operette kennt. Eine Stadt, theaternärrisch und leichtsinnig, wo immer getanzt, gesungen, gegessen und geliebt wird, wo sich niemand Sorgen macht und niemand arbeitet. Ein gewisses Stück Wahrheit ist, wie in jeder Legende, darin. Gewiss, man hat in Wien gut gelebt, man hat leicht gelebt, man suchte mit einem Witz alles Unangenehme und Drückende abzutun. Man liebte Feste und Vergnügungen. Wenn die Militärmusik vorübermarschierte, ließen die Leute ihre Geschäfte und liefen auf die Straße ihr nach. Wenn im Prater der Blumenkorso war, waren dreimalhunderttausend Menschen auf den Beinen, und selbst ein Begräbnis wurde zu Pomp und Fest. Es wehte eine leichte Luft die Donau herunter, und die Deutschen sahen mit einer gewissen Verachtung auf uns herab wie auf Kinder, die durchaus nicht den Ernst des Lebens begreifen wollen. Wien war für sie der Falstaff unter den Städten, der grobe, witzige, lustige Genießer, und Schiller nannte uns Phäaken, das Volk, wo es immer Sonntag ist, wo sich immer am Herde der Spieß dreht. Sie alle fanden, dass man in Wien das Leben zu locker und leichtsinnig liebte. Sie warfen uns unsere ‚jouissance‘ vor und tadelten zwei Jahrhunderte lang, dass wir Wiener uns zu viel der guten Dinge des Lebens freuten.
Nun, ich leugne diese Wiener ‚jouissance‘ nicht, ich verteidige sie sogar. Ich glaube, dass die guten Dinge des Lebens dazu bestimmt sind, genossen zu werden und dass es das höchste Recht des Menschen ist, unbekümmert zu leben, frei, neidlos und gutwillig, wie wir in Österreich gelebt haben. Ich glaube, dass ein Übermaß an Ambition in der Seele eines Menschen wie in der Seele eines Volkes kostbare Werte zerstört, und dass der alte Wahlspruch Wiens ‚Leben und leben lassen‘ nicht nur humaner, sondern auch weiser ist als alle strengen Maximen und kategorischen Imperative.“