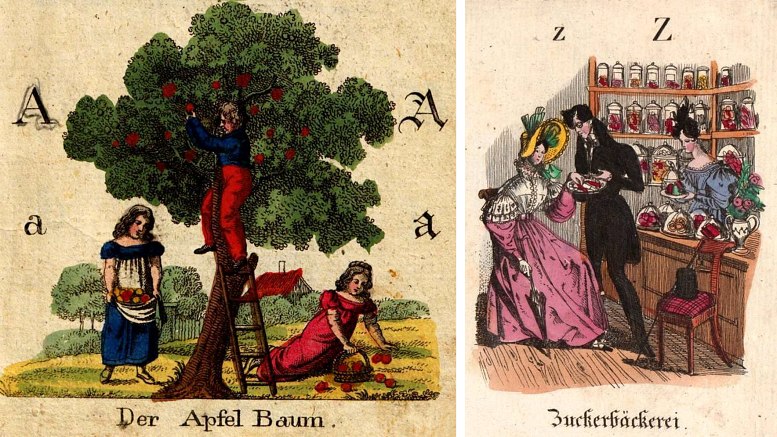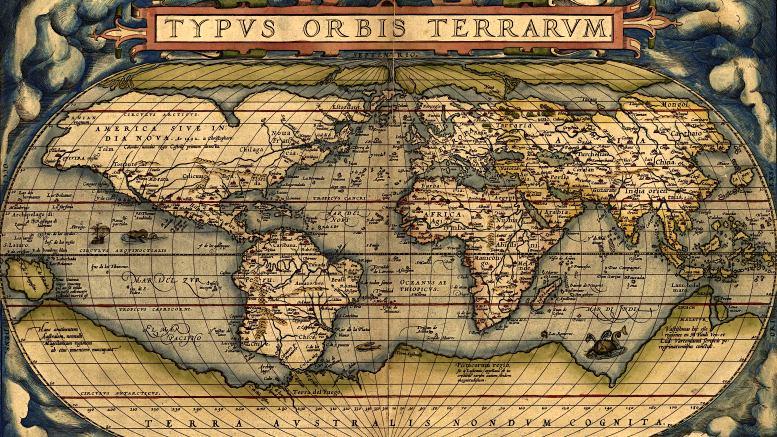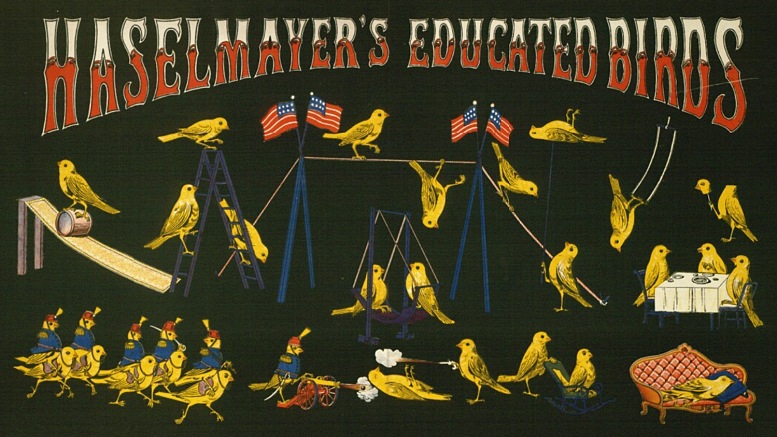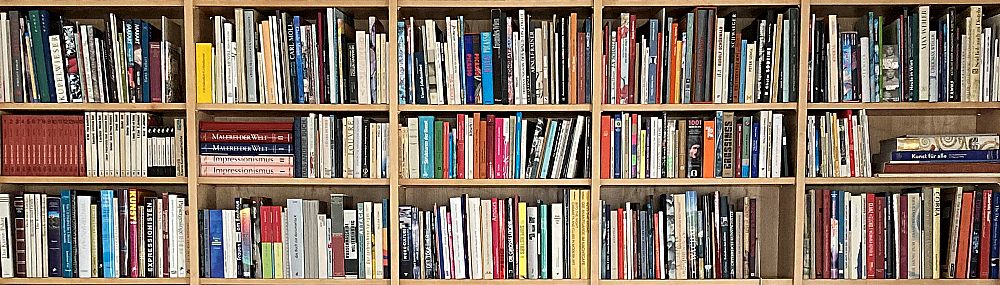Es gibt Biografien, die lassen einen sprachlos zurück. Einfach deswegen, weil man sich nicht vorstellen kann, wie manche Menschen in der Lage sind, mit anscheinend unerschöpflicher Energie am laufenden Band gegen alle Hindernisse Taten zu setzen, die nicht dem eigenen Wohl dienen, sondern einzig und allein dem Wohlergehen der Allgemeinheit gewidmet sind.
Im konkreten Fall ist die Rede von Lina Morgenstern, die vor nahezu zweihundert Jahren, am 25. November 1830, in Breslau, heute Wroclaw (Polen) in eine gutbürgerliche jüdische Familie hineingeboren wurde. Im Unterhaltungsblatt der „Vossischen Zeitung“ war 1930, also anlässlich ihres 100.Geburtstags und 21 Jahre nach ihrem Tod (sie starb 79-jährig 1909) Folgendes zu lesen: „Ihre Zeitgenossinnen beschrieben sie als klein, rundlich, lustig, voll Energie, spontan, weltoffen und in manchen Bereichen chaotisch.“
Bei der Feier ihres 18. Geburtstages gründet sie – nachdem sie die blutige Niederschlagung der Revolution 1848 hat mitansehen müssen – den „Pfennigverein“, der Bleistifte, Papier und Kleidung für Schüler*innen kauft, deren Eltern sich das nicht leisten können, und der bis in die 1930er Jahre existiert. 1896, also mit 66 Jahren holt Lina Morgenstern – als Höhepunkt ihres Wirkens – den „Internationalen Frauenkongress“ zum ersten Mal nach Deutschland und setzt bei dieser achttägigen Tagung, bei der über 1700 internationale Delegierte in Berlin zusammenkommen, über alle Parteigrenzen hinweg neue Impulse für die Frauenbewegung.
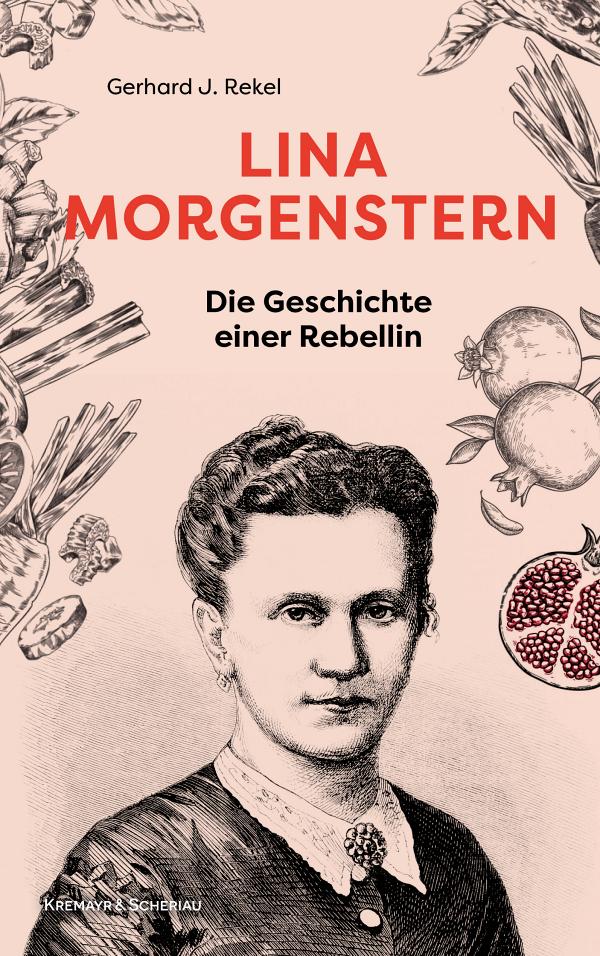
Diese so überaus beeindruckende Biografie stellt nun Gerhard J. Rekel in den Mittelpunkt seines Buches „Lina Morgenstern Die Geschichte einer Rebellin“. Rekel ist Absolvent der Filmakademie Wien und Regisseur von Wissenschaftsdokumentationen. Als Verfasser von Tatort-Drehbüchern und als Romanautor hat er die erzählerische Kraft und auch den langen Atem, um über das unglaubliche Leben von Lina Morgenstern zu schreiben. Er macht mit den unvorstellbaren sozialen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts vertraut, schildert gleich im ersten Kapitel, wie Lina 1870 mit ihren Helferinnen im Deutsch-Französischen Krieg die aus den Kampfhandlungen zurückkehrenden, verwundeten Soldaten auf dem Berliner Bahnhof betreute, und zwar sowohl deutsche als auch französische, und wie sie in all dem Chaos es dann doch zu Wege brachte, die offiziellen Stellen auf diese Schande der in allen Belangen unbetreuten Soldaten aufmerksam zu machen. Erst dann beginnt der Biograf mit der Familiengeschichte, und auch die war nicht ganz so einfach, nennt er doch das erste Kapitel „Turbulente Vorgeschichte“. Als Sechzehnjährige lernt Lina in der Tanzschule den polnischen Flüchtling Theodor Morgenstern kennen und lieben, hat daraufhin sieben Jahre zu warten, bis ihre Familie endlich die Zustimmung zur Eheschließung gibt. Kinder kommen auf die Welt, Lina muss erkennen, welche Anstrengung das neben ihren anderen Tätigkeiten bedeutet, sie initiiert die ersten Kindergärten in Berlin, und das, obwohl die Regierung Kindergärten verboten hat, sie schreibt Kinderbücher und Anleitungen für Mütter und Erzieherinnen unter dem Titel „Das Paradies der Kindheit“, organisiert Ausbildungsstätten für Kindergärtnerinnen, um dann im Krieg Preußen gegen Österreich 1866 die Institution zu gründen, die ihr auch den Beinamen „Suppen-Lina“ eintrug, nämlich die erste Volksküche. (Linas Schwester Cecilia Adler gründete daraufhin mit hundert bürgerlichen Ehrendamen Volksküchen in Wien, „wo sich bereits am ersten Tag fast tausend Besucher über Lungenbraten mit Erdäpfeln und Apfelstrudel freuen durften“, wie die „Nationalzeitung“ 1871 berichtet.) Ein „Kinderschutzverein“ und eine „Akademie zur wissenschaftlichen Fortbildung von Damen und Arbeiterinnen“ folgten.

Es ist hier nicht genügend Platz, um all das nur anzuführen, womit sie sich karitativ beschäftigte – und das immer über alle sozialen, wie konfessionellen Grenzen hinweg. Wie gesagt, der Biograf kann das alles erzählen, die persönlichen Details, die soziale Umgebung im Kaiserreich, die Rückschläge und die Niederlagen, von denen Lina Morgenstern sich immer wieder erholte. Sie war antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, aber auch solchen von der immer stärker werdenden sozialistischen Bewegung, die ihr vorwarf, sich an die höheren Schichten anzubiedern. Natürlich tat sie das, einfach um ihre Ziele zu erreichen, um wieder neue Geldquellen zu erschließen, um neue Gönner*innen zu finden.
Rekel hat umfassend recherchiert, in vielen Quellen das Grundlagenmaterial für seine Biografie gefunden. Eine Zeittafel steht am Ende seines Buchs, dann die Aufzählung der fünfzehn Vereine, die Lina gegründet, die Titel der über dreißig Bücher, die sie geschrieben hat, die Adressen der Berliner Volksküchen und Rezepte aus Linas Bestsellern. Dazu gehört ihr „Universalkochbuch“ mit 2731 Rezepten, die oft außergewöhnliche Bezeichnungen hatten, wie zum Beispiel der Nachtisch „Ehestandsnüsse“. Das ist eine Masse aus Vanille, Zucker, zehn Eiern, Mehl und Eischnee, die auf ein mit Olivenöl bestrichenes Blech gesetzt wird und im nicht zu heißen Ofen gebacken wird. Auf neue Essgewohnheiten ging sie in ihrem Buch „Die fett- und fleischlose Küche“ ein und nimmt da neben Makkaroni mit Pilzen auch eine Nusstorte mit Mohrrüben auf den Speisezettel. Neben all dem, worum sich Lina Morgenstern gekümmert hat, war ihr gesundes Essen – und das im 19. Jahrhundert – immer wichtig.
Gerhard J. Rekel: Lina Morgenstern. Die Geschichte einer Rebellin. Verlag Kremayr & Scheriau, 2025.
2.9.2025