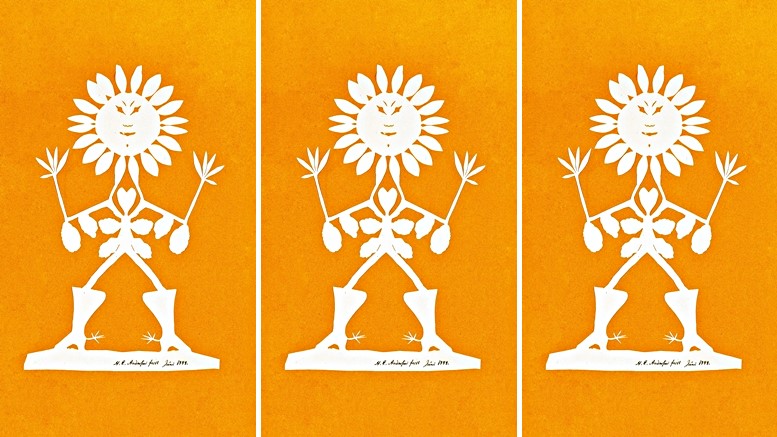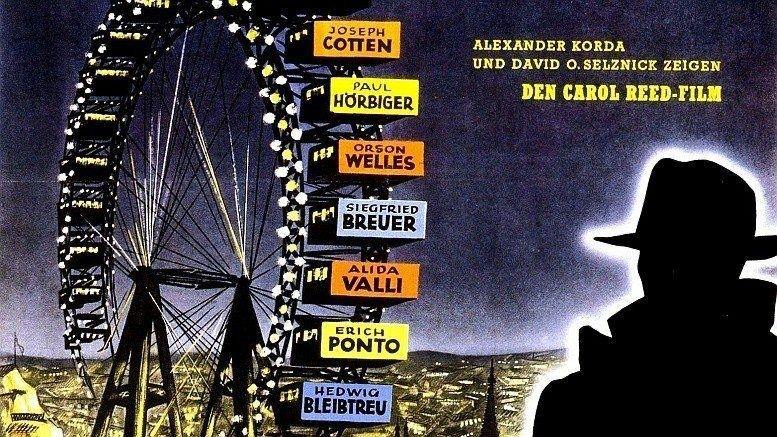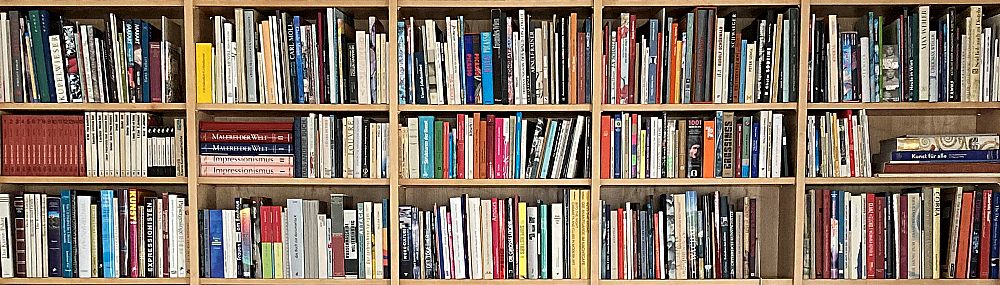Bevor hier auf Herman Melvilles berühmtestes Werk, den Roman „Moby Dick“, eingegangen werden soll, ein paar Worte über das eher unglückliche Leben des am 1. August 1819 in New York City geborenen Autors. Die Biografie liest sich allein schon wie ein Abenteuerroman: armselige Kindheit, als Schiffsjunge auf den Weltmeeren unterwegs, immer wieder geflüchtet, immer wieder gefangen genommen. Nach fünf Jahren Matrosendasein wird er sesshaft, heiratet, von seinen vier Kindern begehen zwei Selbstmord. Nach anfänglichen schriftstellerischen Erfolgen zieht er sich auf eine Farm zurück. Er schreibt dort „Moby Dick“ und kündigt das Werk seinem Verleger an als „Abenteuerroman, der auf gewissen wilden Legenden aus den Pottwalfanggebieten im Süden gründet, ausgeschmückt mit den eigenen persönlichen Erfahrungen des Autors aus seiner mehr als zweijährigen Zeit als Harpunier.“ Doch die Farm muss er aufgeben, von dem 1851 publizierten Roman werden zu Melvilles Lebzeiten nur rund dreitausend Exemplare verkauft. Melville fristet in der Folge sein Leben als Zollinspektor im New Yorker Hafen, er stirbt 1891.

„Moby Dick“ geriet in Vergessenheit und wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Hätte es die 1956 herausgekommene Verfilmung von John Huston, an deren Drehbuch immerhin Ray Bradbury mitgearbeitet hatte und in der – mit seiner Leistung ganz und gar nicht zufrieden – Gregory Peck in der Rolle als Kapitän Ahab zu sehen war, hätte es die nicht gegeben, wäre die Geschichte vom weißen Wal in unseren Breiten vermutlich weiterhin ein Fall für Literaturwissenschaftler und Spezialisten geblieben.
Der Schriftsteller D.H. Lawrence schrieb 1923 in einem Essay über „Moby Dick“: „Es ist ein großartiges Buch“, aber auch „als Seelen-Geschichte macht es einen wütend“ –, um letztendlich festzustellen: „Es ist ein unvergleichlich schönes Buch, mit einer schauderhaften Aussage und voll böser Überraschungen“. Es wird darauf ankommen, ob man solcherart literarisch eingestimmt werden muss, oder ob man das Abenteuer Melville selbständig beginnt. In allen Fällen wird es Meeresstille und wilde Fahrt geben, Entfremdung und Anteilnahme, man wird mit Langeweile rechnen müssen, sollte aber auch auf wahnwitziges Pathos und überschäumende Action-Szenen gefasst sein. Und weil dieses Buch so ganz ohne Ironie geschrieben ist, sollte man sich immer an die Aussage von D.H. Lawrence erinnern: „Moby Dick, der große weiße Wal, hat Ahab das Bein am Knie abgerissen, als dieser einmal auf ihn losging. Völlig zurecht. Hätte ihm gleich beide Beine abreißen sollen, und noch einiges mehr dazu.“
Lawrence hatte den „Moby Dick“ immerhin im englischen Original gelesen, wie aber ist es, wenn die – besonders in Melvilles Gebrauch – fremde Sprache übersetzt werden muss? „Eigenwillig, dunkel, ungehobelt, fremd, kompromisslos, eigenartig“ – das sind die Adjektiva, die Friedhelm Rathjen im Anhang zu dem von ihm auf seine besondere Art und Weise übersetzten Buch, erschienen im Verlag „Jung und Jung“, vermerkt. (Die Kritik an den diversen Übersetzungen des „Moby Dick“ gäbe noch einmal eine eigene Geschichte her, wie da nämlich Meinungen unversöhnlich aufeinanderprallen.) Ein optischer Höhepunkt dieser Ausgabe – die auch den Essay von D.H. Lawrence enthält – sind die Holzschnitte von Raymond Bishop aus dem Jahr 1933. In ihrem kompromisslosen Schwarz-Weiß übertragen sie das Pathos Melvilles voll und ganz ins Bildliche.

Urlaubs- und Ferientage sind wahrscheinlich die beste Zeit, um sich dem „Moby Dick“, der – je nach Übersetzung und Einsatz von Illustrationen – zwischen 750 und 850 Seiten dick ist, zu widmen. Aber Melville hat so viel geschrieben, dass man auch auf Kürzeres zugreifen kann. Zum Beispiel „Israel Potter“. Das ist ein historischer Roman, der während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges spielt und ein wenig an die barocken Abenteuer des Simplicissimus erinnert. Was aber hier – wie auch in anderen Büchern Melvilles, außer „Moby Dick“ und „Mardi“ – auffällt, ist, zu welch bissiger Ironie er fähig ist, gleichzeitig aber auch in bitterste, wenn nicht gar larmoyante Melancholie abgleiten kann. Interessant wäre es zu erfahren, was Uwe Johnson 1961 bewogen haben mag, dieses Buch ins Deutsche zu übertragen.
Wieder einen anderen Einstieg in das Werk Melvilles bietet die 2019 im Verlag „Jung und Jung“ erschienene Essaysammlung „Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen“, in der Alexander Pechmann Texte „Von Walen, Dichtern und anderen Herrlichkeiten“ übersetzt und herausgegeben hat. Da findet man neben dem Begriff „Salzwasserpoesie“ auch einiges über das Thema Tätowieren – mit dem man ja immer augenscheinlicher konfrontiert wird – und in unseren Tagen, in denen amerikanische Literatur den Weltmarkt überschwemmt, kaum vorstellbar: Gedanken über die Möglichkeit einer Abnabelung der damals ja noch sehr jungen amerikanischen von der englischen Literatur.
So, aber nun wieder ein Schwergewicht, ein Sonderfall nicht nur in Melvilles Werk, sondern überhaupt der damaligen Literatur: „Mardi und eine Reise dorthin“. Noch immer merkt man den Kommentaren auch unserer Tage über diese Schilderung einer ganz eigenartigen Südseereise das Staunen an, das völlige Überraschtsein. Rainer G. Schmidt hat das Buch für die im Manesse Verlag erschienene Ausgabe übersetzt und kommentiert. Man wird seinen Kommentar als Wegweiser durch knapp 800 Seiten ungehemmtes Dahinerzählen brauchen. Melville, der am Ende seines Lebens ja auch Lyrik schrieb, baut in diese Südseereise immer wieder Lyrismen und fantastisch ausufernde Beschreibungen ein. Und überforderte auch damit nicht nur seine Zeitgenossen.
Bleibt neben vielen anderen Werken auf jeden Fall noch „Billy Budd“, die Geschichte vom schönen, unschuldig schuldig gewordenen Matrosen. Das ist wahrlich ein rätselhaftes und schwieriges Buch, vielseitig und unklar, erst lang nach Melvilles Tod erschienen. Dieses, sein letztes, Werk ist unvollendet geblieben und, so meint Daniel Göske im Nachwort zu der von ihm für den Hanser Verlag übersetzten Fassung, hat erst in der großartigen Oper von Benjamin Britten seine Vollendung gefunden.
Es sind große Namen, die uns immer wieder auf Melville hinweisen: D.H. Lawrence, Albert Camus, Uwe Johnson, Wilhelm Genazino, um nur einige zu nennen. Anlass genug, ihren Anregungen zu folgen. Möglichkeiten dazu gibt es genug, denn die Werke Melvilles sind in zahlreichen Auflagen als Hardcover, Taschenbuch und auch als E-Books erhältlich.
22.8.2022